Geologischer Überblick
Wer von München kommend auf der Autobahn in Nordrichtung
reist, überquert bei Ingolstadt die Donau, fährt vorbei an Feldern auf eiszeitlichen
Lößlehmböden und tertiärer Süßwassermolasse und erreicht kurz darauf den sanften
Anstieg der Juratafel der Südlichen Frankenalb. Offene Hochflächen und ausgedehnte
Waldgebiete wechseln sich ab, dann folgt die steile Abfahrt ins Altmühltal mit einem
Höhenunterschied, der in etwa dem noch weiter nordwärts gelegenen Steilabfall der
Weißjurastufe entspricht. An diesen gelangt man nach kurzem Weg durch ein Nebental der
Altmühl nördlich von Greding, um sodann in die weite Lias- und Keuperlandschaft des
Albvorlandes einzufahren. Eine Autofahrt von nur etwa 20 Minuten - aber eine Reise vorbei
an Gesteinsfolgen aus 200 Millionen Jahren Erdgeschichte!

Nur den wenigsten dürfte
bewusst sein, dass sie bei der
Fahrt über die Albhochfläche, zwischen den Juragemeinden Lenting und Denkendorf, über
Gesteinslagen ihren Weg nehmen, die zu den berühmtesten der Erdgeschichte zählen:
Plattenkalke der Altmühlalb, 150 Jahrmillionen alte Schichtenfolgen, die zwischen
Donauwörth und Regens-burg über eine Länge von rund 100 km der Albtafel auflagern - und
das bei einer Breitenerstreckung von bis zu 25 km und einer Mächtigkeit von örtlich mehr
als 150 m. Wie der Blick auf eine geologische Karte zeigt, bilden sie jedoch kein
zusammenhängendes Vorkommen, sondern erscheinen fleckenartig verteilt. Sie werden
großflächig unterbrochen durch massige, hellgraue, oft zuckerkörnige oder in harten
Dolomit umkristallisierte Riffkalkgesteine, die an den Talflanken der Altmühl und ihrer
Nebenflüsse durch die Verwitterung bisweilen zu malerischen Felstürmen und Bastionen
herausgeformt wurden. Der Wechsel von Schichtgesteinen und Riffgesteinen ist kennzeichnend
für den Weißjura der Südlichen Frankenalb und ein erster Schlüssel für das
Verständnis der Bildung von Plattenkalken.
Zur Entstehungszeit der Ablagerungen des Weißen Jura (auch Oberer Jura oder Malm genannt) vor rund 160 - 145 Millionen Jahren war das Gebiet der heutigen Frankenalb von einem warmen, subtropischen Meer bedeckt. Dieses erstreckte sich über den Alpenraum hinweg (die Alpen wurden erst 100 Jahrmillionen später aufgefaltet) bis zum Mittelmeergebiet. Nordwestlich und östlich, in jeweils etwa 30 - 100 km Abstand vom heutigen Altmühljura, begannen ausgedehnte Festlandsgebiete, die Mitteldeutsche Insel und die Böhmische Insel. Küstenlinien, Meerestiefe und Wasserverhältnisse wechselten im Laufe der Jahrmillionen. Die heute vorherrschend hell gefärbten Mergel, Kalke und Dolomitgesteine des Weißjura entstanden aus tonigen und kalkreichen Ablagerungen am Meeresgrund. Feinste Tontrübe wurde von den Festlandsgebieten angeliefert, Kalkschlamm und Riffkalk entstanden im Flachmeer durch die Tätigkeit von Mikroben und riffbildenden Organismen sowie, zu einem vermutlich geringeren Teil, wohl auch durch anorganische chemische Ausfällung.
Der Boden des flachen Schelfmeeres unseres Raumes
war durch hügelähnliche Riffbildungen in Schwellen und Senken (Becken oder
"Wannen") gegliedert. Auf dem Meeresboden gediehen rasenartig wachsende becher-
oder tellerförmig ausgebildete Kieselschwämme. Zwischen ihnen setzte sich Kalkschlamm
fest und darauf sowie auf den Kieselskeletten der abgestorbenen Schwämme bildeten
kalkabscheidende "Blaualgen" (Cyanobakterien) und andere Mikroben feste
Kalkkrusten. Diese boten nun wiederum eine günstige Unterlage für das Wachstum neuer
Schwammgenerationen und weiterer Rifflebewesen. Dadurch wuchsen die Riffe allmählich
kissen- oder kuppenförmig über ihre untermeerische Umgebung empor und erreichten
Durchmesser von vielen hundert Metern. Mit zunehmender Verflachung des Schelfmeeres
starben viele der Mikroben-Schwammriffe ab und auf ihren Kuppen siedelten, insbesondere im
Osten und Süden unseres Gebietes, die auf Licht und bewegtes Wasser angewiesenen
Korallen. Einige der alten Mikroben-Schwammriffe ragten vermutlich sogar als Inseln über
die Wasseroberfläche.
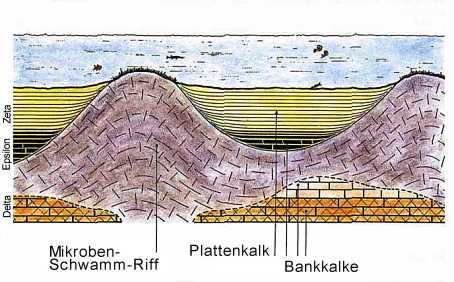
In den großräumigen, schüsssel- und wannenförmigen Vertiefungen zwischen den Riffbauten lagerte sich feinkörniger
Kalkschlamm in gering- bis
dickbankigen Lagen ab - es entstanden Bankkalke, Mergel und Plattenkalke. Bei günstigen
Lebensbedingungen am Meeresboden mit ausreichender Sauerstoffversorgung
bildeten sich
dickbankige Kalkablagerungen, die starke Durchwühlung durch Bodenlebewesen und daher
keine Feinschichtung sowie unebene Schichtflächen aufweisen. Guterhaltene Fossilien in
Weichteilerhaltung sind in diesen Bankkalken nicht zu erwarten, lediglich Steinkerne (z.B.
von Ammoniten), Gehäusereste und andere organische Hartteile. Demgegenüber sind
fossilreiche Plattenkalke in der Regel ein Hinweis auf lebensfeindliche oder zumindest
ungünstige Bedingungen, die einem reichen Bodenleben abträglich waren und somit eine
Durchwühlung des Sediments verhinderten. Plattenkalke zeigen daher meist eine deutliche
Feinschichtung und ebene Gesteinsoberflächen. Es gibt allerdings auch
Plattenkalkhorizonte, die in stärkerem oder schwächerem Maße Bodenleben dokumentieren
und dann Spuren oder Grabgänge (z.B. von Krebsen, Muscheln, Würmern etc.) zeigen.
Bisweilen ist der Übergang von Plattenkalken zu Bankkalken fließend.
Alle oben genannten Gesteinstypen - Riffkalke, Bankkalke, Mergel und Plattenkalke - konnten in ähnlicher oder gleicher Gesteinsausbildung (Fazies) während unterschiedlicher Zeiträume gebildet werden; ebenso konnten sie aber auch zur gleichen Zeit in unmittelbarer Nähe zueinander entstehen. Unterschiedliche Gesteinsausbildung bedeutet also nicht unbedingt ein anderes geologisches Alter - dagegen können sehr ähnlich aussehende Gesteinsfolgen (z.B. Kieselplattenkalke) auch aus unterschiedlichen Zeitabschnitten stammen! Einige charakteristische Schichtenfolgen der Altmühlalb wie die Dickbänke des "Treuchtlinger Marmors" oder die lithographischen Kalke der "Solnhofener Schichten" des Raumes Eichstätt / Solnhofen sind jedoch, bedingt durch besondere paläogeographische Rahmenbedingungen, so typisch ausgeprägt, daß sie selbst vom Laien eindeutig zugeordnet werden können.
Nach alter süddeutscher Geologentradition werden seit
Leopold VON BUCH (1839) und F.A. QUENSTEDT (1856-1857) die jurazeitlichen Schichtenfolgen
des Schwarzen Jura (Lias), Braunen Jura (Dogger) und Weißen Jura (Malm) jeweils durch die
ersten sechs Buchstaben des griechischen Alphabets weiter untergliedert: a (Alpha),
b (Beta),
g (Gamma),
d (Delta),
e (Epsilon),
z (Zeta). Daneben
finden auch die internationalen Stufennamen (Zeitbegriffe!) Anwendung, wie Oxfordium,
Kimmeridgium und Tithonium für den Oberen Jura. In der beigefügten Grafik der
Schichtenfolgen sind beide Gliederungen aufgeführt. Der Einfachheit halber wird im
folgenden die süddeutsche Einteilung nach den Gesteinen bevorzugt.
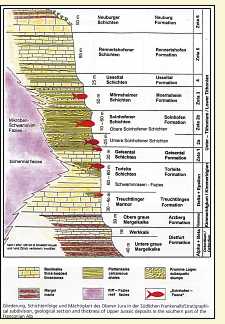
In dem stratigraphischen Schema
(siehe Abbildung, für Details - bitte anklicken) ist eine ideale Schichtenfolge
dargestellt. Im Gelände sind, bedingt durch unterschiedliche Ablagerungsbedingungen,
Verwitterung, Abtragung und Talbildungen, nur selten alle Schichtglieder vorhanden. Im
Zuge der Alpenfaltung wurde die Albtafel in Südrichtung geneigt. Die jüngeren
Gesteinsfolgen des Weißjura Zeta 4 - 6 fielen im nördlichen und zentralen Bereich des
Altmühljura der Abtragung zum Opfer. Überdeckt werden die Weißjuragesteine örtlich von
jüngeren Sedimenten.