Eine kurze Einführung in die
Solnhofener Plattenkalke, Kapitel 3
Die Solnhofener Plattenkalke
Als sich die Solnhofener Schichten
(Weißer Jura Zeta 2, Solnhofen-Formation) vor 150 Millionen Jahren ablagerten, bildeten
sich, wie schon eingangs betont, sowohl Riffkalke als auch Bankkalke und verschiedene
Typen von Plattenkalken.
Die "lithographischen" Solnhofener Plattenkalke sind das wirtschaftlich und
geowissenschaftlich bedeutsamste Gestein dieser Schichtenserie. Sie bestehen aus einer
Wechsellagerung von harten Kalken, den "Flinzen" und
dazwischengeschalteten
Mergellagen, den "Fäulen". Die Flinze setzen sich zusammen aus reinem
mikritischem (d.h. aus mikrokristallinen Calcit bestehenden) und homogenem Kalk (96 - 98 %
Calciumcarbonat). Hauchdünne Tonbeläge auf den Flinzen gewährleisten die Spaltbarkeit
der Platten. Die Fäulen besitzen einen hohen Tonanteil und sind daher deutlich weicher,
weisen aber immer noch einen beachtlichen Kalkgehalt auf (75 - 90 % Calciumcarbonat).
Fossilien kommen sowohl in den Flinzen als auch in den Fäulen vor, können aber beim
industriellen Abbau der technisch nutzbaren Flinze leichter aufgefunden werden als in den
Fäulenlagen, die man meist unbesehen auf die Halde kippt.

Gegliedert werden die Schichten im Solnhofener und
Eichstätter Gebiet in die Unteren Solnhofener Plattenkalke (Weißer Jura Zeta 2a) und die
Oberen Solnhofener Plattenkalke (Weißer Jura Zeta 2b). Sie werden getrennt durch eine
gleitgefaltete, ineinander verknetete Schichtenfolge, die "Trennende Krumme
Lage". Eine weitere gestörte Schichtenfolge ("Hangende Krumme Lage") liegt
auf den Oberen Solnhofener Plattenkalken. Die Krummen Lagen entstanden vermutlich durch
großflächige untermeerische Abgleitbewegungen von halbverfestigten, ganz leicht schräg
geneigten Schichtpaketen.
Aufschlüsse in den Unteren Solnhofener Plattenkalken des Zeta 2a sind spärlich, da die tonreicheren, von den Steinbrechern "Merischiefer" genannten Lagen nur selten abgebaut wurden (z.B. an der Wegscheid bei Eichstätt). Nahezu alle heutigen gewerblich genutzten Steinbrüche sind in den Oberen Solnhofener Plattenkalken des Zeta 2b angelegt, die im Eichstätter Raum eine Mächtigkeit von maximal 20 m erreichen, bei Solnhofen dagegen über 50 m mächtig werden.
Der Ablagerungsraum der
Solnhofener Plattenkalke wird
häufig als "Lagune" beschrieben. Abgesehen davon, daß nicht eine
einzelne
Lagune, sondern eine Vielzahl von Plattenkalkwannen und Riffschwellen vorhanden waren,
verbindet man zumeist mit dem Begriff Lagunen die Vorstellung von küstennahen,
langgestreckten, seichten Strandseen, die durch Strandwälle oder Riffgürtel vom offenen,
tieferen Meer getrennt sind. Das offene, tiefere Meer jedoch lag zur Entstehungszeit der
Solnhofener Plattenkalke weit im Süden, im heutigen Alpenraum. Zwischen den Landgebieten
im Norden und Nordosten (Mitteldeutsche Insel und Böhmische Insel) und dem heutigen
Alpenraum erstreckte sich ein weites, flaches Meeresgebiet, eine sogenannte
Flachwasserplattform (Karbonatplattform). Sie war durch Mikroben-Schwamm-Riffe in
untermeerische Schwellen und Senken gegliedert. Unser Raum lag im nördlichen Teil dieser
ausgedehnten Flachwasserplattform.
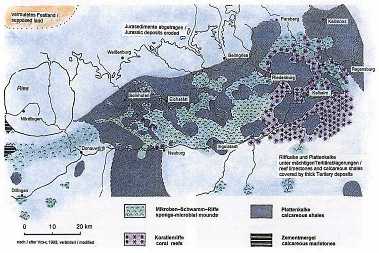
Die Zeichnung (für Details, Abbildung anklicken) zeigt
die Riffareale und Plattenkalkwannen der Südlichen Frankenalb. Im Norden sind die
Sedimente abgetragen und so unserer Beobachtung entzogen, südlich der Donau tauchen sie
tief unter die Molassebildungen und sind nur aus vereinzelten Tiefbohrungen bekannt.